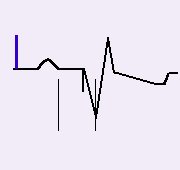
Vorbereitung
Bewertung der Meßdaten:
Überprüfen, ob die Meßdaten bezüglich Stimulationsfrequenz und Amplitude mit den programmierten Werten übereinstimmen. Liegen die gemessenen Werte niedriger, so muß eine Erschöpfung des Aggregates angenommen werden.
Überprüfen der Elektrodenimpedanz: Bei den modernen Elektroden darf die Impedanz bis 2000 kiloOhm und sogar noch darüber liegen, ohne daß ein Elektrodendefekt vorliegt. Wichtig ist bei Bewertung der Impedanz vor allem die Änderung der Impedanzparameter im Verlauf, nicht der Ausgangswert. Fällt die Impedanz plötzlich ab, so muß die Elektrode auf einen Isolationsdefekt untersucht werden. Steigt die Impedanz massiv an - meist kombiniert mit einem Exit - Block-, so ist die Elektrode disloziert oder gebrochen. In beiden Fällen muß eine Röntgen - Thorax - Aufnahme angefertigt und der Verlauf der Elektrode kontrolliert werden. Wichtig ist, daß man bei Anfertigung der Röntgenaufnahme die Radiologen auf das Problem hinweist, damit die Aufnahme auch in der richtigen Technik angefertigt wird. Eine normale A.P.- Aufnahme läßt die Elektroden oft im Herzschatten verschwinden. Bei geeigneter keV - Intensität lassen sie sich gut abgrenzen. Zur Not muß man durchleuchten, was aber die Strahlenexposition deutlich erhöht.
Batteriedaten:
Spannung: Die meisten Schrittmacher besitzen bei guter Batterie
eine Spannung von ca 2,8 V. Meist ist ab einer Spannung < 2,3 V der
Austauschzeitpunkt erreicht. Dies ist je nach Schrittmacher unterschiedlich
und muß der Fachinformation entnommen werden. Bei 1,8 V ist das Funktionsende
erreicht.
Innenwiderstand: Die Lithium - Jod - Batterie hat in vollem Zustand nahezu keinen Innenwiderstand. Demenstprechend findet man bei voller Batterie einen Innenwiderstand von < 1 kOhm. Bei Zerfall der Ionen in Lithiumjodid steigt der Innenwiderstand an. Dieser führt zur Absenkung der Ausgangsspannung. Der Anstieg des Innenwiderstandes ist nicht linear, sondern exponentiell, so daß bei Erhöhung des Innenwiderstandes auf 4 kOhm die Kontrollintervalle verkürzt werden sollten.
Stromverbrauch: Hoher Stromverbrauch > 30 mikroA. Bei hohem Stromverbrauch und Anstieg des Innenwiderstandes sollte man die Kontrollintervalle noch weiter verkürzen.
Welche programmierbaren Werte
sind absolut wichtig ?
(Unterstrichenes wird noch weiter
erläutert )
Einzuberechnen sind die normalerweise verlängerten Leitungszeiten im Vorhof durch den unphysiologischen Stimulationsort der Vorhofelektrode. Durch die Lage der Vorhofelektrode an der anterolateralen Vorhofwand werden oft die präformierten Vorhofleitungsbahnen zur Signalübermittlung nicht verwendet. Vielmehr läuft die Erregungswelle diffus über das Myocard und z.T. transseptal und hat dadurch deutlich verlängerte interatriale Leitungszeiten. Man kann sagen, daß auch auf Vorhofebene eine Art —Linksschenkelblock" mit der entsprechenden Leitungsverzögerung besteht. Dies sieht man oft an einem Spike- P - Abstand, d.h das erzeugte P kommt erst einige Zeit nach dem Spike. Die elektromechanische Kopplung im Vorhof ist also verzögert.
Anders verhält es sich bei eigener Vorhofaktion. Hier wird der Vorhof physiologisch erregt und es findet somit kaum eine Leitungsverzögerung zwischen beiden Vorhöfen statt. Bei Sinuserregung der Vorhöfe erfolgt die elektromechanische Koppelung beider Vorhöfe also schneller und synchroner, als bei Vorhofstimulation.
Dies bedingt, daß die AV - Zeit normalerweise länger zu wählen ist, als das PV - Intervall.
Wie findet man die optimalen Zeiten ?
Man kann mittels Doppler-Echocardiographie mit Flußmessung über der Mitralklappe und Programmierung von 2 verschiedenen AV - Zeiten ( lang und kurz ) die AV - Zeit optimieren
Die Formel ( nach Lembke ):
Optimiertes AVD = AVD lang ( 250 msec ) - (( VS - MS lang ) - ( VS - MS kurz ))
VS = Ventrikelspike MS = Mitralklappenschluß
Man programmiert also erst eine lange AV - Zeit und mißt die Parameter im Echo. Gleiches geschieht bei kurzer AV - Zeit. Die Differenz wird von der langen AV - Zeit abgezogen.
Möglichkeit der PV - Zeit Optimierung aus dem Oberflächen - EKG ( nach Koglek )
Messung von Ende P bis zu Mitte R oder S ( entspricht der isovolumetrischen Kontraktionszeit = IVKZ )
Formel:
( EP - IVKZ ) - Eigene Überleitung oder Normwert 120 ms = x
Aktuelle PV - Zeit im EKG - x = Programmiertes PV - Intervall
Möglichkeit der AV - Optimierung aus dem Oberflächen - EKG ( nach Koglek )
Der Patient wird AV - sequentiell stimuliert
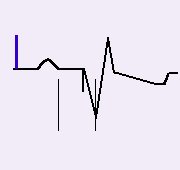
Formel:
( EP - IVKZ ) - Eigene Überleitung oder Normwert 120 ms = x
AV - Zeit ( spike to spike ) - x = Programmierte AV - Zeit
Obere Grenzfrequenz
Grundsätzlich dient die obere Grenzfrequenz als Schutz des Patienten vor einer ungebremsten 1:1 Überleitung von wahrgenommenen Vorhoftachycardien. Sie dient nicht zur Leistungsbremse des Patienten, wofür sie leider oft eingesetzt wird.
Um die obere Grenzfrequenz sinnvoll programmieren zu können, muß man zuerst über die unter Belastung maximal erreichbare Eigenfrequenz Bescheid wissen. Also muß man den Patienten ergometrieren und somit die maximal erreichbare Eigenfrequenz bestimmen.
Die programmierte obere Grenzfrequenz wird dann 20 - 30 Schläge über diesen maximalen Eigenaktions - Wert eingestellt und dort mittels Regulierung der PVARP ein 2:1 Block eingerichtet. Eine Wenkebach - Periodik in diesem Bereich ist unnötig und könnte zur Induktion einer Endless - loop - Tachycarde führen.
Sinn dieser Programmierung ist:
1. der Patient wird nicht durch den Schrittmacher leistungsgemindert,
also nicht durch eine schrittmachervermittelte AV - Blockierung plötzlich
hämodynamisch labil
2. sollte der Schrittmacher durch eine retrograde Leitung über
den AV - Knoten eine Reentry-Tachycardie initiieren, so wird sie durch
den 2:1 Block wieder terminiert.
Programmiert man die obere Grenze nach diesem Muster, so muß man sich nicht mehr um die Bestimmung der retrograden VA - Leitung kümmern und die PVARP danach justieren.
VES - Option ( PVC - Option )
Dient zum Verhindern einer Reentry - Tachycardie über eine retrograde
Leitung.
Sollte immer programmiert werden !
Möglichkeiten:
Einschalten !
Sie dient zum Vermeiden einer Inhibition des Ventrikelkanals durch
den Vorhofimpuls im Rahmen eines AV-Crosstalk. AV - Crosstalk bedeutet,
daß der Ventrikelkanal den Vorhofspike senst und dadurch inhibiert
wird. Dies würde zu einer Ventrikelasystolie führen. Die Blanking
- Periode ist der zu programmierende Zeitraum, in dem der Ventrikelkanal
nach Abgabe des Vorhofimpulses blind geschaltet ist und keine Aktionen
wahrnehmen kann. Ein guter Wert ist 38 ms
Ist die Blanking-Periode zu kurz gewählt, so kann es zu AV - Crosstalk
kommen; ist sie zu lang, so werden VES, die in die Blanking-Zeit fallen
nicht wahrgenommen und es könnte theoretisch zur Abgabe eines Ventrikelimpulses
in die vulnerable Phase der VES kommen und somit Kammerflimmern
ausgelöst werden.
Um die Blanking-Zeit kurz wählen zu können und somit die Detektion von VES zu ermöglichen, empfiehlt sich die bipolare Wahrnehmung, die per se schon die Wahrscheinlichkeit des Crosstalk vermindert. Wird die ventrikuläre Empfindlichkeit relativ niedrig eingestellt, so wird auch damit ein Crosstalk vermieden.
Ventrikuläre Sicherheitsoption ( Safety window pacing )
Einschalten !
Hier handelt es sich um eine zusätzliche Überwachungsperiode
nach Ablauf der Blanking-Zeit. Wird am Ende der BP eine VES innerhalb des
Sicherheitsfensters erkannt, so wird am Ende dieses Fensters ( in der Regel
etwas 100 ms nach dem Vorhofspike ) eine ventrikuläre Sicherheitsstimulation
abgegeben. Somit wird das Risiko der Asystolie durch Inhibition des Ventrikelkanals
durch einen atrialen Spike verhindert. Hat es sich um eine wahrgenommene
VES gehandelt, so erfolgt der Sicherheitsimpuls in die natürliche
Refraktärzeit der VES und ist somit ungefährlich
PMT - Option ( ELT = endless loop tachycardia )
Einschalten !
Im neuesten Algorithmus der Trilogy - Generation von Pacesetter programmiert
man —Auto detect" und hat damit seine Schuldigkeit getan. Dieser Modus
untersucht, ob das P fix an den QRS - Komplex gekoppelt ist oder nicht,
um so zwischen einer physiologischen Tachycardie und einer PMT zu unterscheiden
Andere Möglichkeit: 10 Schläge > MTR => werden mehr als 10 Schläge
außerhalb der oberen Grenzfrequenz wahrgenommen, so wird die PVARP
verlängert und somit der retrograd geleitete Ventrikelstimulus im
Vorhof nicht mehr gesehen.
Was ist bei der Programmierung spezieller Modi zusätzlich zu beachten?
Die Indikation des DDI ist das Sinusknoten - Syndrom und auch der seltene Fall eines echten Carotissinussyndroms. In beiden Fällen muß die AV- Überleitung intakt sein, sonst wäre dieser Modus ungeeignet. Der DDI - Modus soll die eigene Überleitung gewähren. Deshalb ist bei der Programmierung folgendes zu beachten:
Lange AV - Zeit programmieren : 300 ms
Lange PVARP programmieren: 350 ms
Sensor
Die Einstellung des Sensors erfolgt bei den neuen Schrittmachern automatisch oder über ein Auto-Set -Programm. Nachfolgend kann man anhand von Sensorhistogrammen überprüfen, ob die Sensoreinstellung für die Bedürfnisse des Patienten adäquat sind.
Unter den programmierten Daten finden sich zwei Parameter, die zu beachten sind:
Frequenzgesteuerte AV / PV - Verzögerung:
Hier kann man meist zwischen den Optionen —klein, mittel, groß"
oder —wenig, mäßig oder aktiv" wählen. Schalten man diese
Option ein, so wird das AV - Intervall unter Belastung verringert. Dies
scheint wenig sinnvoll, da es dadurch zu einer Annäherung der Vorhofkontraktion
an die Ventrikelkontraktion und damit auch zu Pfropfungen im Vorhof kommen
kann. => Ausschalten ! bzw. gar nicht erst aktivieren
Kürzestes AV / PV - Intervall
Dieser Wert ist nur von Bedeutung, wenn die AV / PV - Verzögerung
eingeschaltet wird und gibt die niedrigste mögliche AV - Zeit unter
Belastung an.
Kann man sich nicht zurückhalten und schaltet die frequenzgesteuerte
AV- Verzögerung an, so sollte dieser Wert nicht unter 80 ms liegen.
Mode switch ( MS )
Die einzig sinnvolle Indikation der Mode switch - Option ist die 2 Knoten - Erkrankung, wo neben einer Vorhofrhythmusstörung zusätzlich eine Störung in der AV - Überleitung besteht. Man muß also einerseits tachycarde Vorhofrhythmusstörungen befürchten, die nicht übergeleitet werden sollen, benötigt aber zur Überbrückung der AV - Überleitungsstörung den DDD - Modus. Mode switch schaltet im Falle wahrgenommener Vorhoftachycardien von DDD nach DDI um. Alle anderen Fälle von Vorhofrhythmusstörungen ohne Überleitungsstörungen sind mit DDI oder AAI besser und sicherer bedient als mit DDD und Mode switch, auch wenn dies momentan modern ist ( daher der Name —Mode" switch )
Damit MS gut funktioniert muß das Vorhofsensing stimmen. Deshalb sollte unbedingt eine bipolare Elektrode verwendet und die atriale Empfindlichkeit auf Maximum gestellt werden ( 0,5 mV ). Dadurch soll die Dedektion von atrialen Flimmer- und Flatterwellen sichergestellt werden, die normalerweise niedrigamplitudiger sind, als die P - Wellen und ständig die Amplitudenhöhe wechseln
Programmieren der ATDR ( atrial tachycardia detection rate ). Dieser Wert gibt an, bei welcher Vorhoffrequenz der Schrittmacher einen MS durchführt. Diese Frequenz muß logischerweise immer oberhalb der oberen Grenzfrequenz liegen und ist auch nicht niedriger als diese einstellbar. Ein vernünftiger Wert läge um 200 - 220/ min. Der Abstand zwischen ATDR und oberer Grenzfrequenz sollte nicht zu gering sein, da sonst ein ständiges Mode switching provoziert werden kann. Der Schrittmacher geht wieder in seinen ursprünglichen DDD - Modus, wenn die atriale Frequenz unter die obere Grenzfrequenz fällt.
PVARP kurz programmieren ( 250 ms ) und obere Grenzfrequenz ( verantwortlich für das minimale Stimulationsintervall ) nicht zu hoch programmieren ( 130/ min ). Dies ist wichtig, da die Monitorfunktion des MS in dem Intervall zwischen PVARP - Ende und Ende des minimalen Stimulationsintervalles stattfindet. Ist die PVARP lange und die obere Grenzfrequenz hoch, so wird keine P-Welle mehr wahrgenommen und Mode switch funktioniert nicht.
PVAB ( postventrikuläres atriales Blanking )
Dieser Wert ist nur bei eingeschaltetem Mode switch von Bedeutung, muß dann aber unbedingt beachtet werden. Wird innerhalb des Mode switch - Monitorfensters eine eventuelle atriale Tachycardie wahrgenommen, so wird das atriale Monitoring aktiviert. Das bedeutet, daß der Vorhofkanal nun jegliche atriale Welle dedektiert und zwar auch in der PVARP. Das heißt, daß in diesem Moment keine PVARP mehr existiert und somit auch ein Far field sensing des Ventrikelstimulus wahrgenommen werden könnte. Dies soll das PVAB verhindern, daß für die einprogrammierte Zeit den Vorhofkanal stumm macht. Man muß es sich wie eine verkürzte PVARP vorstellen. Ein sinnvoller Wert liegt um 100 ms.
Hat man all dies beachtet und programmiert kann man fast aufatmen. Eines fehlt aber noch und zwar die abschließende Ergometrie. Sie ist wichtig, weil sich Sensing - Defekte meist erst unter Belastung zeigen ( vor allem im Vorhof ). Also Patient belasten und dabei das Programmer - EKG und die Marker im Auge behalten. Sollte es zu Sensingausfällen kommen ( sichtbar am Verlust des —P" oder —R" im Marker ), so muß die Empfindlichkeit des entsprechenden Kanals vergrößert werden, d.h. der mV-Wert reduziert werden.
So, jetzt ist man entgültig fertig. Noch eine letzte Abfrage des Schrittmachers mit Ausdruck und ein abschließender Blick auf die programmierten Werte, dann kann man den Programmer abschalten.
Abschließend Aktualisierung des Schrittmacherausweises und der Kartei und Vergabe eines neuen Termins.
Copyright by Dr. Adrien Hümmer, 10/1997